Novellen haben den Vorteil, dass sie meist flink zu lesen sind, denn sie sind definitionsgemäß eher kurz. Problematisch dabei ist, eine tiefgehende Wirkung zu erzielen, wenn doch der Raum zum Entfalten der Geschichte so begrenzt ist. Umso mehr kommt es auf das
Können des Autoren an. Er muss eine
spannende Geschichte erzählen, oder eine oberflächlich gesehen langweilige auf spannende Weise. Er sollte dabei den
Leser bei der Stange halten, gerade auch mit den Mitteln seiner Sprache. Doch verschwurbelte Schachtelsätze bieten sich auf dem begrenzten Seitenraum der Novelle gemeinhin nicht unbedingt dafür an. Jedoch, eine bloße Anhäufung von Fakten ohne stilistische Besonderheiten, gehen am zu erreichenden Ziel auch wieder vorbei. Man sieht, es ist fürwahr eine
Kunst, eine gute Novelle zu verfassen.
Zwei von ihnen sind "Ein fliehendes Pferd" von Martin Walser und "Ich und Kaminski" von Daniel Kehlmann. Es stehen sich also zwei Generationen des teutschen Schriftstellertums gegenüber. Dies aber nicht unversöhnlich und erst recht nicht ohne Gemeinsamkeiten. Gemeinsam haben sie z.B., dass sie mit diesen beiden Werken zwei
gute Zeugnisse ihrer Kunst fabriziert haben.
Wer Martin Walser heute kennt, wird an ihn als einen alten, weißbehaarten Mann denken, der mit seinem schweizerisch angehauchten Dialekt und wohlklingender tiefer Stimme wie der
respektierte, lebenskluge, aber etwas eigensinnige Opa des Dorfes wirkt. Manche werden sich an die für ihn stürmische Zeit vor etwa 10-15 Jahren erinnern, in der er aufgrund einer Rede und eines anschließend veröffentlichten Buches arg im Fokus der (Medien-)Kritik stand.
Dass nun dieser Mensch in "Ein fliehendes Pferd" über
zwei Beziehungen, die gegenteiliger nicht sein könnten, schreibt, sollte noch nicht verwundern, hat er doch in den letzten Jahren fast ausschließlich über die zwei Themen geschrieben, welche unvergänglich sind: Liebe und Tod. Sehr wohl überraschend wirkt aber der
Stil und die unverblümte Taktlosigkeit, mit der er in seiner Novelle die Geschichte so oft auflockert. Walser hatte wohl einen geradezu diebischen Spaß daran, vulgäre Episoden und Ausdrücke in seine Geschichte einzuflechten.
Erfrischend und unverhofft! Die Geschichte bleibt dabei jedoch stets im Vordergrund und wird gerade am Ende umso spannender. So sollte es sein!
 |
| Bloß keine Zähne zeigen! (Quelle) |
Kehlmann's "Ich und Kaminski" dagegen punktet eher mit seiner
bizarren Handlung und mehr oder weniger
offensichtlichen Seitenhieben auf Kunst und Kritik derer. Wenn man so will, geht es bei Walser eher gemächlich los, bei Kehlmann mit einem Paukenschlag. Sofort wird der Kritiker, mit dem sich der Leser identifizieren soll (oder auch nicht), hinreichend beschrieben, indem sein Arschloch-Verhalten, seine Eingebildetheit und seine heimliche Angst vor dem Zerbrechen dieser Mauer offengelegt wird.
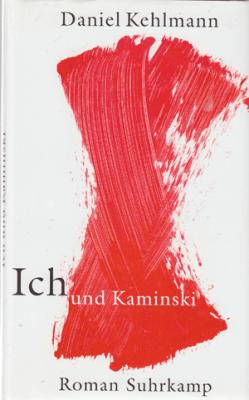 |
Ist das Kunst oder kann das weg?
(Quelle) |
Die Geschichte vom
Kritiker Zöllner, der schnell Geld machen will, weil er den längst vergessenen Künstler Kaminski mit einer Biographie "würdigen" will, welche schnell auf den Markt geschmissen werden soll, da Kaminski kurz vor dem Exitus steht - ja, diese Geschichte ist reich an
plakativen Momenten, welche Klischees übererfüllen, aber auch reich an
Wendungen, die man als Leser so nicht erwartet. Im Zuge dieser bröckelt die Überlegenheit des Kritikers gegenüber dem Künstler langsam dahin und ein melancholisches Ende läßt einen sowohl zufrieden als auch ein wenig traurig zurück. Melancholie eben.
Beide Novellen haben das gewisse Etwas, jeweils auf verschiedenen Ebenen. Walser höre ich jedoch lieber zu, er ist gemütlicher und wirkt
ungezwungener und nicht überehrgeizig. Allerdings ist gerade dies das Privileg der Alten.



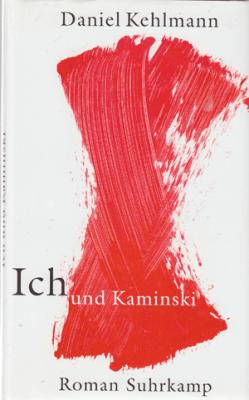
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen