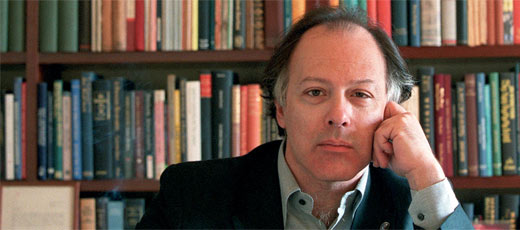Was ist der Zauber des Milan Kundera? Was fasziniert mich an ihm? Bei wenigen habe ich solche Schwierigkeiten, dies klar herauszuarbeiten. Ein mittlerweile 88 Jahre alter Mähre aus Brünn, lebt er schon Jahrzehnte nicht mehr in seiner Heimat. Ende der 70er-Jahre wanderte er aus der Tschechoslowakei nach Frankreich aus. Die Bücher, welche ich von ihm gelesen habe, drehen sich alle im Prinzip um zwei Subjekte: das Persönliche im Rahmen des Politischen. Genauer gesagt: das Zwischenmenschliche (und allzu menschliche) in der Situation des beginnenden und bestimmenden Sozialismus in der Tschechoslowakei. Er schreibt darüber, wie sich die Beziehungen zwischen Menschen in dieser historischen Situation verhalten.
 |
| Link |
So weit, so gewöhnlich. Um eine Faszination zu erläutern, bedarf es natürlich mehr. Wobei man natürlich immer auch die Frage stellen kann, ob es überhaupt möglich ist, etwas so subjektives wie Faszination objektiv zu erläutern. Nun, ich bin kein Anhänger des Gedankens, dass man Erklärungen zu unterlassen habe, weil man sonst Gefahr läuft, genau diesen Zauber zu zerstören. Bei diesen hoch persönlichen Zugetanheiten gibt es immer eine Geheimzutat, die kein Außenstehender verstehen kann. Und meistens man selbst eben auch nicht. Keine Gefahr also...
Ich würde Milan Kundera von seinem Stil ein wenig mit Javier Marias vergleichen: sehr transparente Einsichten in die Intentionen der Handelnden, stilmäßig eher knapp und klar, trotzdem sind die Sätze von Wärme getragen. Und wo Marias sich eher dem Mystery-Aspekt verschreibt, sieht sich Kundera oft als absolut auktorialer Erzähler mit der Macht, seine Figuren schicksalsträchtig hin und herzuschubsen. Aber - und das ist wichtig: stets mit einem gutmütigen Schmunzeln. Man stellt sich einen entspannten erfahrenen Erzähler vor, der auf seine Figuren blickt, sie liebt und gerade deswegen nie verurteilt. Er will ihre Intentionen herausstellen, egal, wo sie herkommen. Gerne erzählt er auch eine Anekdote, breitet seine (stets originellen) philosophischen Ansichten aus und manchmal wird er tatsächlich ein wenig böse, aber nie lang. Und wenn es ganz schlimm um seine Figuren steht, leidet er mit und erzeugt dieses Leid auch bei seinen Lesern. Auch das jedoch eher selten, Kundera weiß um die Vergänglichkeit von extremen Emotionen. Kurz: Kundera ist dein lebenserfahrener Lieblingsopa, der eine spannende Geschichte erzählt.
 |
| Link |
Am besten gefallen mir seine Frühwerke, quasi bis zu seiner Emigration. Darauf basiert meine Einschätzung und Beschreibung seiner Schreibweise. Neuere Bücher habe ich bis auf "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" noch nicht gelesen. Dieses wohl bekannteste Buch von ihm hat mir nicht so gut gefallen wie seine frühen Werke. Nichtsdestotrotz fasst es die o.g. Punkte sehr gut zusammen. Es hat meines Erachtens jedoch einen Nachteil: es legt mehr Wert auf das Erzählpanorama, also auf das Ausbreiten und Ausgestalten der eher spärlichen Geschichte. Die Kritiker liebten es natürlich und es wurde verfilmt. Aber - wie schon gesagt - die frühen Geschichten sind jene, mit denen ich mich eher identifizieren kann.
Literaturkritiker teilen sein Werk in drei Teile ein: die oben erwähnten Frühwerke vor der Emigration, die Mittelperiode (mit der unerträglichen Leichtigkeit des Seins) und seine Spätwerke. Wollen wir mal sehen, was diese bieten. Empfehlen kann ich die Frühwerke, sie sind wundervoll komponiert.

.jpg/170px-Dmitrij_Dmitrijevi%C4%8D_%C5%A0ostakovi%C4%8D_(%D0%94%D0%BC%D0%B8%CC%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%CC%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%CC%81%D0%B2%D0%B8%D1%87).jpg)