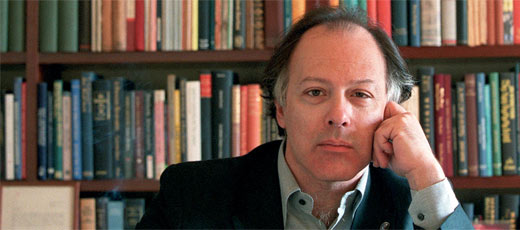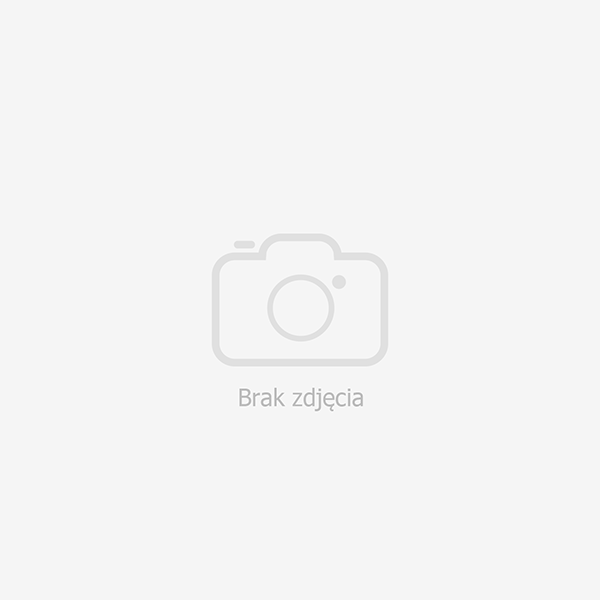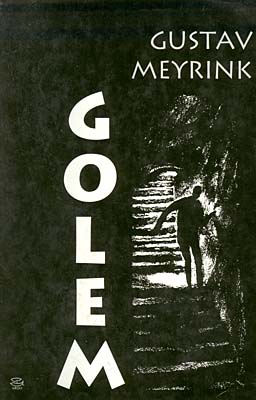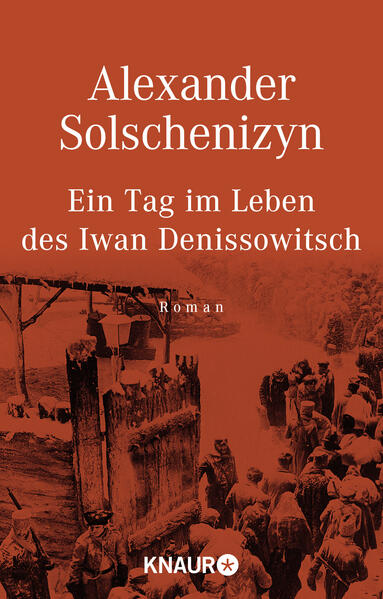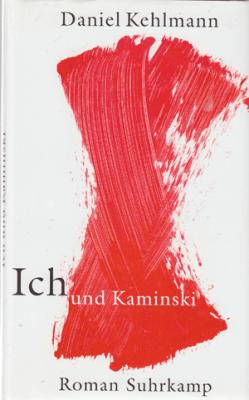Der Titel verrät dem Leser schon eigentlich alles, was zu wissen ist. Es geht um eine untergegangene Welt, um unwiederbringlich Verlorenenes, eben um das Gestern. Herausragender Vertreter und gleichzeitig sein Chronist ist Stefan Zweig - einer der erfolgreichsten Autoren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Konsequenterweise ist Zweig selbst mit dem Gestern zusammen untergegangen. Er beging 1942 im Exil während des 2. Weltkrieges Selbstmord.
 |
| Link |
Eine auf den ersten Blick reichlich überraschende und vielleicht sogar übertrieben wirkende Handlung. Und auch wenn Zweig ein sensibler und ein wenig dünnhäutiger Vertreter der Autorenzunft war, so erklärt sich diese Tat dennoch nicht vollkommen. Um hinter das Geheimnis seines Freitodes zu kommen, muss man natürlich versuchen, sich den Fakt, dass das Kriegsglück sich 1942 bzw. spätestens 1943 schon der Alliiertenseite zuwand, aus dem Kopf zu schlagen. Weiterhin sollte man den Lebensweg Zweigs miteinbeziehen und seine Überzeugungen und Ideen im Hinterkopf haben. Quasi an dem Platz, den man sich eben noch freigeschlagen hat.
Zweig ist kurz gesagt ein Kind des ausgehenden 19. Jahrhunderts und zwar des Wienerischen 19. Jahrhunderts. Damals eines der Zentren des kulturellen Betriebes in Europa und vor allem Schmelztiegel diverser Kulturen, war die Donaumetropole und Hauptstadt des Kaiserreiches Österreich-Ungarns die perfekte Umgebung für einen aufstrebenden Künstler mit Standesbewusstsein wie Zweig. Er bezeichnete sich immer als Europäer und hatte als Ideal das friedliche Zusammenleben und den ständigen kulturellen und menschlichen Austausch aller Leute dieses Kontinents.
Das gleichzeitig aber stattfindende Hochkochen der nationalistischen Bestrebungen bis zum Siedepunkt 1914 versetzte ihn in erstmaliges Entsetzen, ganz ungleich vieler seiner Zeitgenossen wie z.B. Thomas Mann. Seine Anstrengungen, das persönliche und berufliche Leben nach dieser Katastrophe wieder in Stand zu setzen, verlangte Zweig einiges ab. Er hatte jedoch einen zunehmenden Erfolg bei den Lesern und alles schien sich Mitte der Zwanziger in die richtige Richtung zu bewegen.
In Salzburg lebend konnte er den gegenüber liegenden Obersalzberg betrachten, aber nicht wissen, dass sein Verhängnis zu diesem Zeitpunkt regelmäßig dort Urlaub machte. Zweig, ein Jude, wurde nach einer geringen Galgenfrist ab 1933 vollständig aus dem öffentlichen Leben getilgt. Er selber war bald im Exil in England. Von dort, unverstanden und unsicher aufgrund der politischen Lage, blieb ihm nur die Rolle des Beobachters und ungehörten Mahners. Bis der Krieg ausbrach und er ins südamerikanische Exil entfloh.
 |
| Link |
Und was folgte, war ein beispielloser Triumphzug Hitlers durch ganz Europa. In Zweigs Augen wurde seine Welt ein Land nach dem anderen zerstört. Rücksichtslos und unumkehrlich. Den Glauben und die Kraft, wieder von vorne anzufangen zu können, hatte er im Angesicht dieser Entwicklungen nicht mehr. Er, ein Europäer. DER Europäer.
Diese Autobiographie ist ein absoluter Genuß für den Leser. Interessante Anekdoten über Zeitgenossen und Beschreibungen von Entwicklungen der damaligen Zeit gibt es. Und vor allem die elegante Schreibweise Zweigs. Er schreibt höchst ehrlich über seine Befindlichkeiten, aber auch über seine Versäumnisse und lässt einen - Achtung Floskel - damit tatsächlich ein Stück weit ein in die Welt von Gestern eintauchen. Welche, wie kann es anders sein, sicherlich auch romantisch idealisiert ist. Aber so etwas zeichnet nun mal einen guten Autoren aus. Dies war ganz ohne Zweifel Stefan Zweig.
Und er hatte ja Recht, diese Welt ist verschwunden. Die Gegenwart beweist es immer wieder aufs Neue.